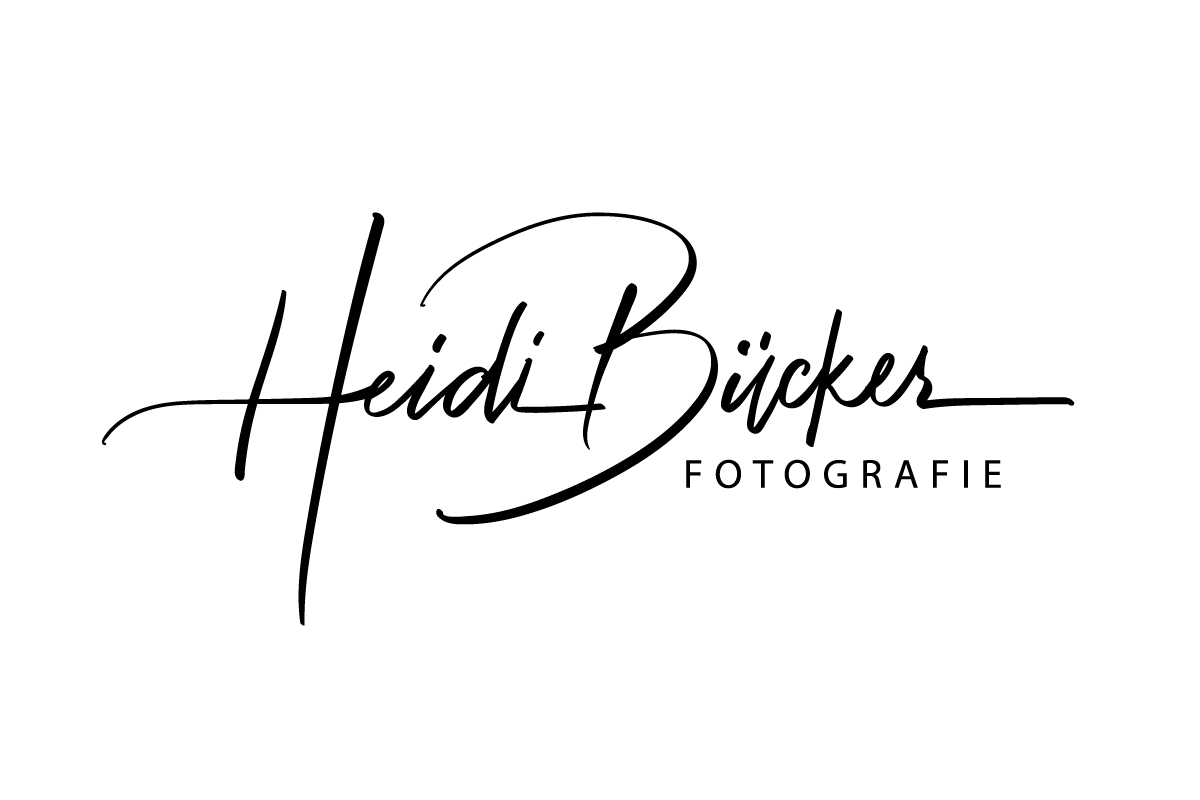Über Grenzen radeln
Es gibt in Neuastenberg einen 14 km langen Themenweg „Über Grenzen gehen“. Er führt entlang der historischen Grenze zwischen Sauerland und Wittgenstein. In der App Outdooractive findet man eine ausführliche Wegbeschreibung, denn der Wanderweg ist nicht durchgehend mit einer einheitlichen Markierung ausgezeichnet. Allerdings ist die Wegführung auch nicht besonders kompliziert.
Ich habe den Themenweg auf 30 Kilometer ausgedehnt und meine persönliche Radtour „Über Grenzen radeln“ daraus gemacht. Start- und Ziel befindet sich an der St. Blasius Kirche in Westfeld.
Los geht´s
Zunächst geht´s die Dorfstraße hinauf in Richtung Skilanglaufzentrum. Dort biege ich auf den Radweg Richtung Ohlenbach ab. Nach ca. 300 m geht´s rechts an den Fischteichen vorbei zum Hohen Knochen. Am Berghotel halte ich mich links und fahre auf dem Waldweg weiter zu den Jagdhütten.
Astenplateau & Lennequelle
An den Jagdhütten zweigen mehrere Wege ab, die fast alle irgendwie auf den Kahlen Asten führen. Der Hohlweg X27 ist mit dem Rad nicht zu empfehlen, deshalb folge ich dem Weg, der nach rechts abbiegt und zunächst leicht bergan führt, später aber steiler wird. Im ZickZack geht´s auf das Astenplateau von wo man eine wunderbare Aussicht in die umliegende Umbebung hat.
Ich quere die Bergheide, wobei ich eine kleine Pause an der Lennequelle einlege. Die Lenne entspringt als höchstgelegene Quelle Nordwest-Deutschlands am Kahlen Asten auf 820m ü. NN. Als intermittierende Schichtquelle, die an einer undurchlässigen Tonschicht in kurzen Abständen mehr oder weniger regelmäßig fließend austritt, wird sie durch Niederschläge und Grundwasser gespeist. Sie zerteilt den Berg nach Westen hin und durchfließt ein Tal, das aufgrund seiner landschaftlichen Vielfalt und den preisgekrönten Dörfern zu den schönsten Tälern in Deutschland zählt. Das idyllische Handwerkerdorf Westfeld liegt als erstes Dorf an der Lenne, die auf einer Länge von 29,8km das Stadtgebiet Schmallenberg durchquert. Sie ist mit 128,2km der größte Nebenfluss der Ruhr und mündet am Fuße der Hohensyburg in dieselbe.
Meine Tour führt links am Astenturm vorbei und geradeaus über den großen Parkplatz, wo ich wieder in einen Waldweg einbiege, der direkt am „neuen Radweg“ endet. Dem neuen asphaltierten Weg folge ich rechts zur alten Landwehr. Hier befindet sich ein Grenzstein, der an die historische Grenze zwischen Wittgenstein und dem Sauerland ( Kölsches Heck ) erinnert. Vor 1975 gehörten die Dörfer Neuastenberg, Mollseifen, Langewiese und Hoheleye zu Wittgenstein. Seit der kommunalen Neuordnung gehören sie zur Stadt Winterberg und dem Hochsauerlandkreis.
Schutzhütte und Grenzstein an der alten Landwehr
Odebornquelle & Wetzstein
Von der alten Landwehr fahre ich links die Straße hinunter zum Helleplatz. Am Ende des Helleplatzes zweigt auf der rechten Seite ein beschilderter Weg in Richtung Mollseifen ab. Diesem Weg folge ich, mache aber vorher noch einen kurzen Abstecher zur Odebornquelle, die sich in unmittelbarer Nähe befindet. Die Quelle der Odeborn liegt auf 720 Metern Höhe am Wetzstein in der Nähe des Höhendorfs Neuastenberg. Neben der Quelle eines kleinen, namenlosen Quellbachs der Odeborn, der am Südosthang des Kahlen Astens am Helleplatz entspringt, steht ein Markierungsstein mit Informationstafel und Verlaufsskizze der Odeborn, sowie einiger Zuflüsse. Die Odeborn mündet nach 22 km bei Raumland (Kreis Siegen-Wittgenstein) in die Eder.
Auf dem Weg nach Mollseifen komme ich an einem alten Steinbruch vorbei. Der Wetzstein ist ein als Naturdenkmal geschützter Steinbruch aus quarzitischen Sandsteinen und Tonschiefern. Die Gesteine haben ein Alter von rund 390 Millionen Jahren und sind dem Unteren Mittel-Devon zuzuordnen. Das besondere ist die Gesteinsfaltung mit Sattel- und Muldenstruktur.
Mollseifen
Weiter geht´s durch schönen Buchenwald zum Bürbigs Platz und von da in das kleine Dörfchen Mollseifen. In Mollseifen fahre ich ein Stück an der L721 entlang und folge der Wegmarkierung WHT ( Winterberger Hochtour ). In einer scharfen Kurve gegenüber des Schneesees biege ich links ab zum alten Mollseifer Grillplatz. Am Grillplatz empfehle ich allerdings, nicht den Pfad über die kleine Brücke zu nehmen, sondern links dem Wiesenweg mit der Wegmarkierung „Richtung Mollseifen“ zu folgen. Der Pfad ist zwar schön, aber nur für Wanderer geeignet. Der Wiesenweg kommt wieder auf einen Waldweg, der am Zwistberg entlang zur Zwistmühle führt.
Die historische Zwistmühle
Von nun an fahre ich über einen grob geschotterten Waldweg entlang des Zwistbergs zur historischen Zwistmühle im Odeborntal. Sie wurde um die Zeit zwischen 1713 und 1727 errichtet, als auch die Höhendörfer Neuastenberg, Langewiese, Hoheleye und Mollseifen gegründet wurden. Die Zwistmühle ist ein historisches Gebäude, das früher als Wassermühle diente. Eine gelb und dunkelbraun gestrichene Mühle, die heute in ihrer Schönheit erstrahlt. Ihr Dach wirkt leicht schräg und verleiht ihr einen besonderen Charme.
Zwistmühle im Odeborntal
Geschichtliches
Der Ausdruck “Zwist” ( Streitigkeit ) deutet darauf hin, dass es zu dieser Zeit nicht sehr harmonisch zuging. Lange vor der Besiedlung war das Grenzgebiet zwischen Wittgenstein und dem Sauerland von Hallenberg über Züschen und die Winterberger Höhendörfer bis hin zum Albrechtsplatz bereits Zankapfel zwischen den Grafen der Freigrafschaft Wittgenstein-Berleburg und den Herrschern des Herzogtums Westfalen, dem Erzbischof von Köln.
Entlang dieser Linie gab es erbitterte Auseinandersetzungen zwischen den katholischen Sauerländern und den protestantischen Wittgensteinern. Die Bezeichnungen Zwistberg, Zwistkopf und Zwistmühle geben ein Indiz für diese Streitigkeiten ab. Dieser lange bis ins 18. Jahrhundert schwelende, weil unentschieden bleibende Territorialkonflikt ist bekannt als der “Winterberger Streit”. Seine Basis war das beiderseitige Interesse an der Nutzung der Waldregion. Während Wittgenstein sich auf das “schon immer” wahrgenommene Jagdrecht berufen konnte, reklamierte Winterberg das Gewohnheitsrecht der Holznutzung für sich. Den Einheimischen ging es vorrangig um Wild sowie die Nutzung von Wald und Weiden, um Nahrung und das dringend nötige Viefutter und Holz zum Überleben zu beschaffen und die Landesherren zankten sich um die Macht im Land.
Zwistmühle
Durch einen politischen Schachzug ließ der damalige Graf Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg im Jahre 1713 den “hohen Norden” mit den Ortschaften Neuastenberg, Langewiese, Hoheleye und Mollseifen besiedeln. Sein Ziel war es, das Waldgebiet am Südhang des Kahlen Astens urbar zu machen, aber auch seine Landesgrenze besser gegen die Winterberger abzusichern. Graf Casimir trug durch seine für die damalige Zeit erstaunliche Toleranz dazu bei, dass sich die beiden Seiten besser zu vertragen begannen, indem er Menschen sowohl aus Wittgenstein als auch aus dem Sauerland unabhängig von ihrer Konfession die Erlaubnis gab, sich gemeinsam anzusiedeln. Als erster Ort wird 1713 Neuastenberg (Niggerduarp) erwähnt, wo sich 14 Siedler niederließen.
Durch diese wittgenstein`schen Neuansiedlungen gewann der Streit an Bedeutung. Eine Einigung, bzw. Beilegung des Winterberger Streits gab es erst im Jahr 1783 und mit der Ratifizierung im Jahr 1805 wurden Neuastenberg und die anderen Höhendörfer entgültig zu Wittgensteinern.
Ironie der Geschichte: Nach der kommunalen Neuordnung im Jahr 1975 wurden die vier Höhendörfer zu Winterberger Stadtteilen und gehören heute zum Hochsauerlandkreis.
Übrigens resultiert der Name “Streitwald” in dem Grenzgebiet rund um die Pastorenwiese zwischen Hallenberg und Wunderthausen auch noch aus dieser Zeit, denn da ging es genauso feindselig zu.
(Quellen: langewiese.de und Heimatliebe-Magazin)
Bierloch & Gehans Äcker
Bei der Zwistmühle fahre ich auf der L721 ein Stückchen zurück – vorbei an der Mühle und dem danebenstehenden Werkstatt-Gebäude. Nach ca. 50 m biegt ein Wirtschaftsweg links ab, dem ich bis zur Schmelzhütte folge. Kurz vor der Schmelzhütte geht´s nochmal über die L721 und danach auf die K52 in Richtung Hoheleye. Allerdings biegt nach wenigen Metern ein Wirtschaftsweg rechts zwischen den beiden Häusern ab. Der Weg führt aus dem Odeborntal stets bergan bis Langewiese. Dort befindet sich ganz in der Nähe das „Bierloch“ mit dem ehemaligen Langewieser Skigebiet.
Die Bezeichnung Bierloch ist kein Zufall, sondern rührt daher, dass im Jahre 1812 Napoleon auf dem Weg nach Russland mit seinen Armeen durch Langewiese gezogen sein soll. Angeblich verlor der Tross dabei ein Fass Bier, das den steilen Berg hinunter ins Odeborntal polterte. Die Girkhäuser im Tal wunderten sich kurz darauf, dass ihr Ziegenhirte jeden Abend betrunken vom Hüten kam. Sie schlichen ihm nach und fanden ihn mit seinem Fässchen Bier. Das wurde umgehend mit Getöse ins Dorf gekarrt und dort mit einem rauschenden Fest komplett geleert. Seit dieser Zeit trägt die Schlucht den Namen Bierloch. (Textquelle: Heimatliebe-Magazin)
An den Wiesen von Gehans Äcker (Gehans ist der Hausname der Schmelzhütte) steht eine Schutzhütte und direkt dahinter biege ich links in einen Wiesenweg ab. Danach geht´s durch einen schönen Buchenwald bis Hoheleye.
In Hoheleye radel ich am Graberhof vorbei leicht bergan über die K52 bis zur B480, die ich überquere. Oberhalb von Bürgers Hof führt ein Weg zum Knäppchen und hinter der „Knäppchenkurve“ geht´s links über einen Waldweg weiter nach Langewiese direkt zum Grenzweg, wo auch der Fernwanderweg Rothaarsteig entlang führt. Der „Grenzweg“ in Langewiese heißt so, weil er die historische Grenze zwischen dem katholischen Sauerland und dem protestantischen Wittgenstein markiert.
Schnadestein am Grenzweg bei Groben
Dem Grenzweg folge ich in Richtung Neuastenberg. Dabei fahre ich über einen leichten Anstieg zum Gerkenstein (792,7 m ü. NN). Hier befindet sich einer von den 42 Seelenorten des Sauerlandes: ein Landschaftsrahmen mit herrlicher Aussicht auf das Höhendorf Langewiese und das dahinter liegende Odeborntal im Wittgensteiner Land. Direkt am Landschaftsrahmen führt ein Pfad hinunter nach Neuastenberg. Dort befindet sich im Unterdorf an der Kirche das Westdeutsche Wintersportmuseum …wirklich sehenswert!
Ich radel noch ein Stückchen weiter über den Grenzweg bis Lenneplätze, wo zwischen den Häusern ein Weg hinunter ins Lennetal und zurück nach Westfeld führt.
Fazit: Schön war´s!